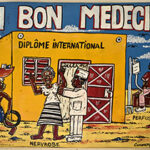Artikel-Schlagworte: „MM“
Robuste & subtile Manualmedizin (mit M.Hyland)
Wer etwas zu sagen hat, wiederholt dies sein ganzes Leben lang. Wer nichts zu sagen hat, läßt sich stets etwas Neues einfallen.
Eine der größten Überraschungen, wenn man von der Behandlung Erwachsener zu der von Kindern kommt, ist die ganz andere Wirkungsweise manueller Therapie (MT), die man dabei kennenlernt.
In der klinischen Anwendung bei Erwachsenen stehen die 1:1 Effekte im Vordergrund: man ist mit einem Problem konfrontiert, geht dieses an und der Patient hat relativ schnell – meist unmittelbar nach der Manipulation – einen überprüfbaren Effekt.
Doch auch bei Erwachsenen hat manuelle Therapie verschiedene Wirkmechanismen: Zum Einen – und dies ist mehr und mehr auch außerhalb manualmedizinischer Kreise akzeptiert – kann sie in der Behandlung solch alltäglicher Probleme erfolgreich sein. Ein klassisches Beispiel ist die Lumbago oder Ischialgie, wo MT heute schon routinemäßig eingesetzt wird. In vielen Fällen beginnt eine derartige Anamnese mit einem gut erinnerlichen Ereignis („..nach der Gartenarbeit…“ – „…dann bin ich gestolpert…“), dem in einem mehr oder weniger langen Intervall dann die Beschwerden folgen, deretwegen der Patient dann Hilfe sucht und oft – dank der Effizienz von MT – auch findet.
Diesen Beitrag weiterlesen »
50 Jahre Manuelle Medizin – Sondernummer der MM oder: Mitleid gibts umsonst, Neid muß man sich verdienen…
Wie gelegentliche Besucher dieses Site schon bemerkt haben werden, bin ich in die Tiefen meiner Archive gestiegen und werde immer mal wieder einiges Interessante daraus hier präsentieren. Als ‚Erbe‘ von F&F (Freimut Biedermann & Friedel Gutmann) beherbergt mein Keller ein recht umfangreiches Archiv, das bis in die Gründungsphase der FAC in den 50gern zurückreicht. Da sind allerlei ‚Schätzchen‘ zu finden, die ein interessantes Licht auf Interna der Manualmedizin werfen. Nun soll man nicht alle Nickeligkeiten ausbreiten, die die jüngere Generation ohnhin nicht interessieren – dachte ich mir immer mal wieder, wenn ich diese alten Korrespondenzen in der Hand hielt. Aber es ist halt manchmal ganz praktisch, wenn man auf die Primärquellen zugreifen kann.
Bei mir war angefragt worden, ein paar Worte zur Arbeit meines Vaters für die Manualmedizin und deren Publikationen zu schreiben. So wußte ich, dass jetzt im Spätsommer 2012 ein dezidiertes Heft zum 50ger Jubiläum der ManMed in Arbeit ist und schlug dieses nach meinem Urlaub auch mit viel Interesse auf. Besonders freute mich, dass der erste Artikel, der hier als Faksimile abgedruckt war, Gutmanns Veröffentlichung zur funktionellen Pathologie der oberen HWS bei Kleinkindern war.
Als ich dann den Kommentar des Kollegen v. Heymann las ( 50 Jahre Manuelle Medizin: „Tonusasymmetriesyndrom“ und „sensomotorische Dyskybernese“ W. von Heymann), wo KiSS als ‚vulgär- populistisch‘ bezeichnet wird …. hab ich erst mal zwei Nächte darüber geschlafen – dann war der Reflex: „Ignorieren“. Und mich ein bißchen gewundert: hab den Herrn nie kennengelernt, was ja eigentlich Voraussetzung für solch emotionale Auslassungen ist. Als ich dann auf dem Website von Springer sah, dass mein KiSS- Artikel von 1993 gar nicht mehr online erreichbar ist, wurde mir klar, dass ich in der Pflicht bin.